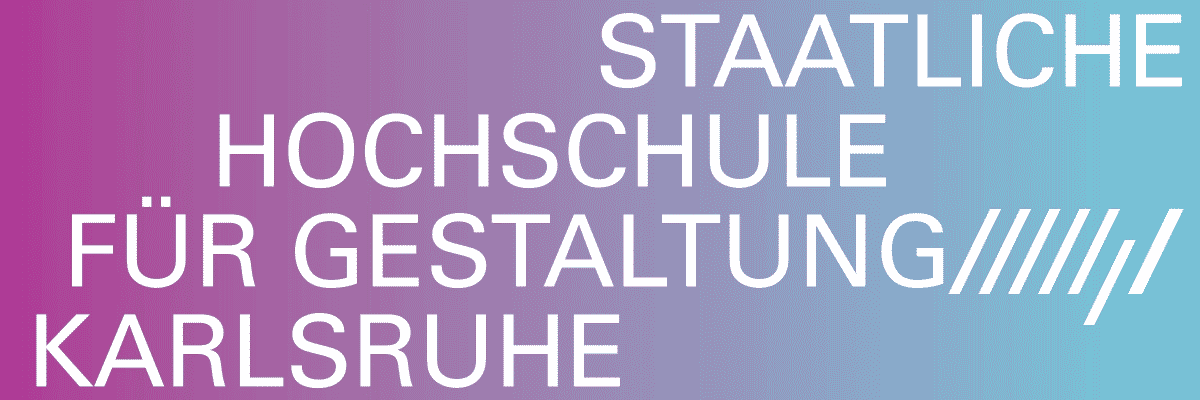Layla Nabi, Thilo Jenssen
immaculate
Project Info
- 💙 MARS Frankfurt
- 💚 team Mars
- 🖤 Layla Nabi, Thilo Jenssen
- 💜 Louisa Behr
- 💛 Robert Schittko
Share on

Advertisement





Das titelgebende Wort „immaculate“ lässt sich mit tadellos, makellos, rein oder perfekt übersetzen. Damit bezieht es sich in erster Linie auf den renovierten Raum, der durch die Duo-Ausstellung von Thilo Jenssen und Layla Nabi eingeweiht wird. Auf den zweiten Blick verbergen sich dahinter jedoch etliche rote Fäden, die sich wie ein verzweigtes Geflecht durch die Arbeiten der zwei Künstler:innen spannen. Der finalen Ausstellung gehen gemeinsame Überlegungen von Jenssen und Nabi voraus, wie sich ihre Werke zusammen inszenieren lassen und wo die Überschneidungen in ihrer künstlerischen Praxis stattfinden.
Ästhetisch offenbart sich den Besucher:innen eine Präsentation makelloser Oberflächen sowie perfekt gearbeiteter Objekten. Darin zeigt sich eine gewisse Ambivalenz: Scheinen die Arbeiten abweisend und unantastbar zu sein, so sind sie in Wahrheit verletzlich. Die kleinste Unvorsichtigkeit führt zu Kratzern und hinterlässt Abdrücke. Die sichtbaren Schweißnähte in den Jenssens Wandarbeiten wirken beispielsweise besonders grob, die glänzenden Oberflächen erzählen allerdings etwas ganz anderes. Entgegengesetzt zum Raum, der jetzt noch „unbefleckt“ und ohne das Echo vergangener Ausstellungen funktioniert und in welchen sich mit jedem darin stattfindenden Projekt Erinnerungen und Referenzen einschreiben werden, lassen sich Jenssens monochrome Metallarbeiten lesen: Schicht für Schicht trägt er in einem langwierigen Prozess den Lack auf die zusammengefügten Diptychen auf. Durch das partielle Abschleifen dessen, legt der Künstler Erinnerungen und Vergangenes – mit anderen Worten eine Topographie der Arbeiten – frei. Inspiriert wurde er unter anderem vom städtischen Raum: In vielen U-Bahnhöfen sind Abgrenzungen aus monochromen Blechtafeln zu finden. Meist sind diese anders als Jenssens Arbeiten ganz und gar nicht makellos. Sie sind beschmiert, ungepflegt und schmutzig. Schicht für Schicht schreibt sich der öffentliche Raum in sie ein.
Eine weitere Werkserie, die Jenssen zeigt, besteht aus pixeligen Fotodrucken auf Leinwand, aus denen Struktur genommen wurde. Abgebildet sind Ausschnitte inszenierter Erste-Hilfe-Griffe aus Anleitungen – sie dienen als Lernmaterial. Oftmals handelt es sich um solche Griffe, die angewendet werden, um Verletzte aus verunfallten Autos zu befreien. Der Vorgang ist mit dem Festhalten sowie Fixieren und dadurch Einschränken der Beweglichkeit der zu bergenden Person verbunden. Losgelöst aus diesem Kontext scheinen die Gesten manchmal fast wie zärtliche Umarmungen. Eine gewisse Ambivalenz manifestiert sich auch hier: Die Griffe dienen zur Stabilisierung, allerdings von höchst verletzlichen Körpern. Sie unterstützen, fixieren aber gleichermaßen. Es bildet sich ein Gegensatz zwischen Halt und Kontrolle. Es entsteht ein Bruch zwischen der Abbildung selbst und dem eigentlich Abgebildeten – genauso wie ein Bruch entsteht zwischen realer Architektur und den Replikaten Nabis. Die Künstlerin geht von realen Objekten innerhalb städtischer Infrastruktur aus und versucht diese zu reduzieren: Die Objekte sollen gerade so auf ihre Funktionalität verweisen und dabei so generisch wie möglich erscheinen. Sie werden zu einer perfekten Attrappe. Nabis Skulpturen bestehen aus eingefärbten MDF-Platten, aus denen sie Replikate in Originalgröße von Architekturen im öffentlichen Raum nachbaut. Im Falle von „immaculate“ handelt es sich um eine Tankstelle und um ein Rohr, das zum Schutz von dahinter befindlichen Reklameflächen dient. Nabi möchte die Objekte von ihrer Aufgabe befreien und dementsprechend existieren sie von nun an nicht mehr aufgrund ihrer Nutzbarkeit. Was ist die Mindestanforderung an ein Objekt, sodass es als solches in seiner Funktion erkannt wird?
Nabi geht in ihrer künstlerischen Praxis der Frage nach, wie sich der öffentliche Raum gestaltet und vor allem, für wen er gestaltet wird. Was wird durch architektonische Strukturen beschützt, für wen ist die Stadt primär gebaut? Schlussendlich lautet eine mögliche simple Antwort, dass die städtische Infrastruktur einer gewissen kapitalistischen Funktionalität entspricht – die omnipräsente Tankstelle beispielsweise ist nur für eine Personengruppe mit Autos interessant. Autos und effizient ausgebaute Straßensysteme sind noch immer ein Symbol für Wohlstand, Erfolg sowie Macht. In Nabis Arbeiten werden die Objekte zu generalisierten Stellvertretern für Fragen nach Zugänglichkeit.
Jenssens Fotodrucke und Nabis Skulpturen sind unter anderem in der Frage nach Dominanzgefügen verbunden. Geht es bei Jenssen um Machtstrukturen im zwischenmenschlichen Miteinander sowie Lenkungsstrategien im Sozialraum, beschäftigt sich Nabi mit Machtstrukturen im öffentlichen Raum und an Transitorten. Verbindend für die Praxis der zwei Künstler:innen ist außerdem das geteilte Interesse an der Gestaltung des städtischen Raumes sowie Wahrnehmungen und Beobachtungen dessen. Sie denken über die Ex- und Inklusion durch gestalterische Mittel nach. Automatisch treten Gedanken zutage, was im Alltag mit der cleanen und funktionalen Ästhetik konnotiert wird – in einer Stadt wie Frankfurt sind makellose und glänzende Oberflächen und minimalistisch gestaltete Räume vor allem im Banken- und Skyscraperviertel präsent. Werden mit ebenjener Ästhetik vor allem Effizienz und Gewinn sowie Machtstrukturen in der Arbeitswelt verbunden? Bringt uns das wieder zurück zu Gedanken über kapitalistische Infrastruktur innerhalb von Städten? Ein Aspekt, mit welchem sich die Künstler:innen bei der Zusammenstellung ihrer Arbeiten beschäftigt haben, beinhaltet die Frage nach den Codierungen des Wahrgenommenen: Welcher symbolische Raum wird für wen aufgemacht, wenn beide Arbeiten zusammenkommen?
Louisa Behr