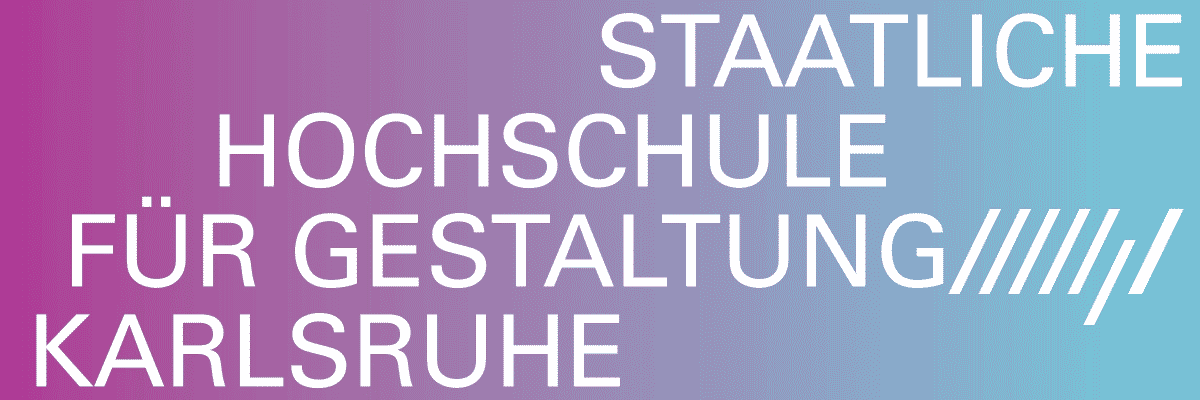
Jens Ertelt, Tobias Krämer, Lars Schwabe, Jan Trinkaus
spin-off
Project Info
- 💙 Kunstverein Friedberg (zu Gast im ehemaligen Novum)
- 💚 Kim-André Schulz
- 🖤 Jens Ertelt, Tobias Krämer, Lars Schwabe, Jan Trinkaus
- 💜 Jens Ertelt, Kim-André Schulz
- 💛 Yvonne Jung
Share on

Ausstellungsansicht, Foto: Yvonne Jung
Advertisement

Ausstellungsansicht, Foto: Yvonne Jung

Ausstellungsansicht, Foto: Yvonne Jung

Ausstellungsansicht, Foto: Yvonne Jung

Ausstellungsansicht, Foto: Yvonne Jung

Tobias Krämer, Inherent vice, 2023, Foto: Yvonne Jung

Jens Ertelt, Slope, 2023, Foto: Yvonne Jung

Jan Trinkaus, Nexus 2 (Auswahl aus 49-teiligen Gesamtbild), 2023, Foto: Yvonne Jung
„Spin-Off“ erzählt von einer Dynamik, die gespeist wird von etwas, das sich seinerseits bereits in Bewegung befindet. Der technische oder wirtschaftliche Kontext ist schnell erklärt, die metaphorische Qualität des Begriffs aber bietet Möglichkeiten für das Etablieren neuen Contents, neuer Erzählbewegungen – ein prägender Bestandteil eines Spin-Offs.
Die Ausstellung versteht sich analog zu diesem Gedanken als Suchbewegung, die entlang der Grenze zwischen konzeptionellen und sinnlich-ästhetischen Diskursen verläuft und Beziehungen zwischen diesen künstlerischen Ausdrucks- und Handlungsfeldern auslotet.
Unterschiedliche Bezüge zur minimalistischen und konzeptgeleiteten Kunst der sog. Postmoderne kommen hierbei in den Sinn: die ephemeren Materialassemblagen von Richard Tuttle, die zeichnerischen Raumerkundungen Joelle Tuerlinckx', die malerischen Nicht-Malereien und Monotypien von Stephan Baumkötter, die spielerischen Abstraktionen von Heimo Zobernik oder die latent ironischen, dynamischen Installationen von Michael Sailsdorfer.
An die Stelle der ästhetischen Verweigerung der konzeptuellen Kunst der 1960er Jahre tritt hier die Suche nach einer neuen, an den Sinnen ausgerichteten Ästhetik, die in jener „Herausforderung an den Geschmack“ mündet, die Clement Greenberg bei der Konzeptkunst vermisste. Dabei geht es jedoch nicht um das bedienen eines konventionellen Genießersinns, sondern um den Nachvollzug komplexer, in sich schlüssiger künstlerischer Gedankenwege und Handlungsweisen.
Peter Osborne nennt das die „anti-ästhetische Verwendung von ästhetischen Materialien“ und beschreibt damit den Rest konzeptueller Strenge in der Neuverwendung und Neuverhandlung konzeptuellen Denkens. Wenn man so will, findet sich die künstlerische Formentwicklung im freien Spiel der Kräfte wieder, sie dreht frei, verknüpft also gedanklich komplexe künstlerische Forschungsarbeit mit einem ästhetischen Freiheitsempfinden.
Daraus resultiert, wie Luke Skrebowski sagt, „ein befreiendes Projekt zur ästhetischen Überwindung der instrumentellen Vernunft“, also eine ästhetische Neuorientierung in gedanklich geleiteten künstlerischen Prozessen. Das künstlerische Tun ist hier nicht mehr auf die Nachvollziehbarkeit der Verwaltungsästhetik ausgerichtet, sondern formuliert, spielerisch, eine eigene, materialgeleitete Sprache – einen Vorschlag, Denkprozesse weiterzuentwickeln. Darin zeigt sich gewissermaßen eine doppelte Bewegung – vom Gedankengang in der Arbeit hin zum Gedankengang beim Betrachten und Erleben.
Jens Ertelt, Kim-André Schulz




