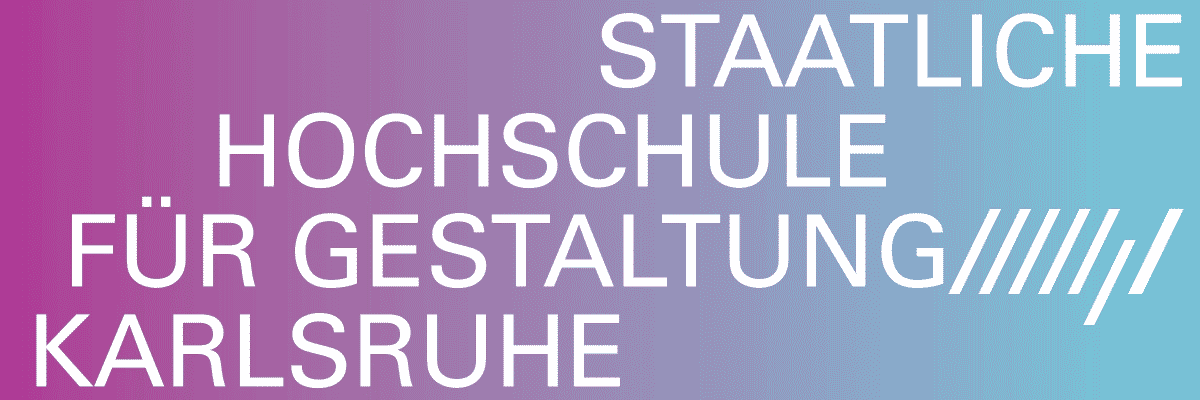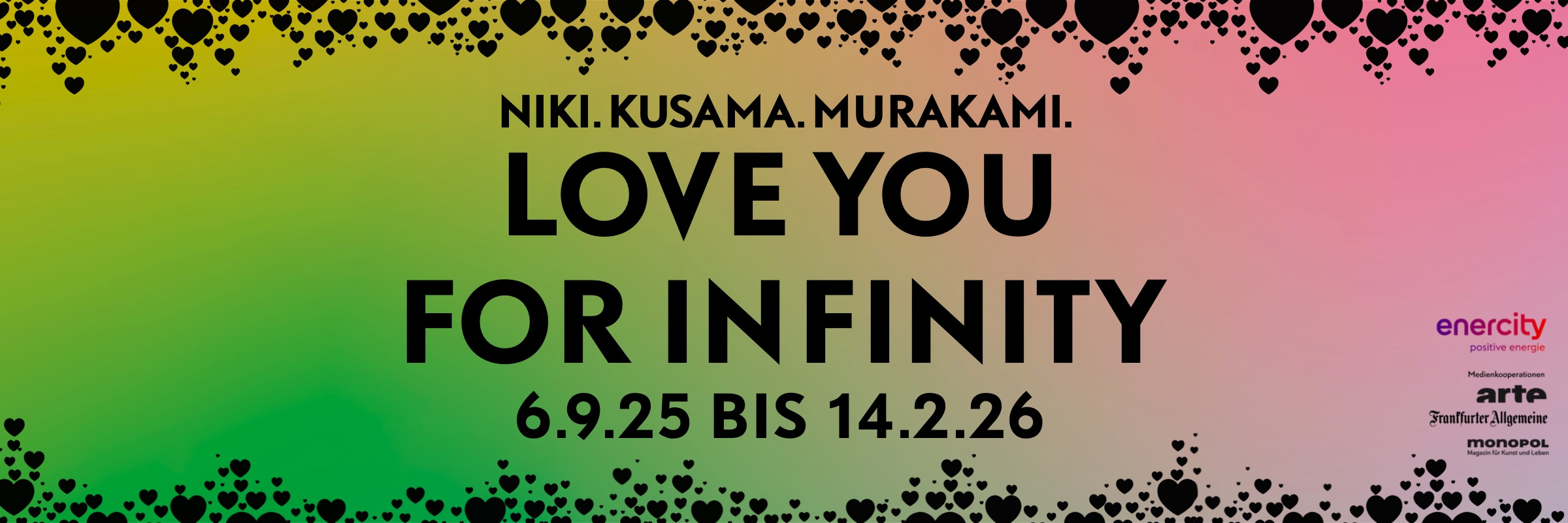
Clara Palmberger-Süsse
Glucose Goddess
Project Info
- 💙 Kunstverein Gastgarten
- 💚 Heiko Lietz
- 🖤 Clara Palmberger-Süsse
- 💜 Heiko Lietz
- 💛 Jonas Mannherz, Felix Gienger
Share on

Happy Pierrot, 155 x 110 cm, Tusche un Öl auf Leinwand
Advertisement

Installationsansicht

Swallow Gum, 155 x 90 cm, Tinte, Grundierung, Papier auf Leinwand

Detail Swallow Gum

Installationsansicht

Swans Succumbing To The Flu, 90 x 65 cm, Öl und Kreide auf Leinwand

Sleeping In A Tradiotional Sense, 155 x 90 cm, Acryl auf Leinwand

Installationsansicht
Clara Palmberger-Süße: Glucose Goddess (30.08 – 08.09)
Die malerischen Arbeiten der Ausstellung Glucose Goddess von Clara Palmberger-Süße schließen sich an ihre künstlerisch-forschende Auseinandersetzung mit dem Rokoko an. Ihr Interesse gilt zum einen dem Fortbestehen seiner Zeichen in aktueller Konsumkultur, die sich beispielsweise in der Verbindung von Lebensmittelkonsum und Vorstellungsbildern des Göttlichen zeigt. Zum anderen gilt ihr Interesse Prozessen schwebender Räumlichkeit und der Betonung von emulsionsartigen Materialitäten, Strukturen und Dynamiken. Besondere Aufmerksamkeit erhalten dabei Figuren der Komposition und De-Komposition, die sie auf ihre Parallelen zu Konstruktion und Dekonstruktion hin befragt.
Einen Bezugspunkt bildet hierbei das Bildgenre der Fête Galantes, die Figuren in Ballkleidern oder Maskenkostümen zeigen, die sich in parkähnlichen Landschaften amorös vergnügen. Palmberger-Süße nähert sich diesem Genre von einem Verständnis des Rokokos als Ausgangspunkt der Konsumkultur und untersucht die Inszenierung von Genuss und Begehren, die diese Bilder nicht nur zeigen, sondern auch selbst verkörpern. So beschreibt die Kunsthistorikerin Ewa Lajer-Burcharth den Rokoko als Epoche, in der Mythos zum Alibi nicht nur für die Darstellung von Vergnügen wurde, sondern ebenso für materielles Vergnügen und des Malens an sich.1 Palmberger-Süßes Arbeiten bewegen sich hieran anschließend zwischen der Thematisierung formalästhetischer Prinzipien des Rokoko und der Auflösung dessen Motive in Form-, Farb- und Kompositionsweisen, die sie durch den Einbezug einzelner motivischer Elemente, wie Girlanden, Blumen oder Infografiken zum Mayonnaisekonsum, dynamisiert. Durch die Aneignung, Variation und Dekonstruktion kompositorischer Prinzipien des Rokokos und deren Verschmelzung mit den abstrakt werdenden Zeichen aktueller Statistiken und Zeichensystemen ergeben sich in den gezeigten Arbeiten verschiedene Reibeflächen und Übergänge, die sich aus dem konstruierten Bildraum in den inszenierten Ausstellungsraum weiterführen. In Bezug zum kompositorischen Prinzip der Rahmung und der Verhandlung des Rahmens im Rokoko, rücken Palmberger-Süßes Arbeiten auch ihren materiellen Rahmen in den Blick und befragen die Beziehung von Textil zu Holzrahmen ebenso, wie die Beziehung von Vorder- und Hinterseiten oder Arbeit und Display.
Formen des Rahmens zeigen sich im Rokoko etwa in Form gestalteter Kartuschen ohne Bildinhalt als künstlerische Form ebenso als bedeutsam, wie als Prinzip, dass ein Feld von Erwartungen aufspannt, dass die Bühne für antizipierte aber entpersonalisierte Konsument*innen bildet.2 Durch den Einsatz von Trockenbaugestellen, die wiederum eine Referenz zu Konstruktion und De-Konstruktion bilden, zeigen sich dementgegen Rahmen und Prinzipien der Rahmung in der Ausstellung als visuelles Prinzip,3 die dem Blick von Besucher*innen verschiedene Möglichkeiten für Bildgrenzen erlauben, die zwischen Bildraum und architektonischen Raum changieren.
Heiko Lietz